... newer stories
Mittwoch, 20. Januar 2021
Der Segestes Verrat - Warum wichen Tacitus und Paterculus voneinander ab ?
ulrich leyhe, 15:54h
Varus war sich der Quellenlage nach zu urteilen absolut darüber im Klaren, sich also der Tatsache voll bewusst, dass er sich wie man annehmen darf, im südlichen Nethegau in ein Krisengebiet begeben würde, wo keine lammfrommen Germanen auf ihn warten würden. Soweit die Faktenlage. Und darauf wähnte er sich militärisch genügend vorbereitet und operativ bestens gerüstet. Das ihm aber darüber hinaus auch noch zusätzliche, vor allem aber größere Risiken und Gefahren drohen könnten soll ihm wenn, dann jedoch nur indirekt möglicherweise aber auch gar nicht angekündigt worden sein. Die strategische Ausgangslage für Varus war also die, dass er zwar von einem räumlich begrenzten Konflikt ausgehen konnte, aber von weiter reichenden germanischen Plänen nichts wusste. Was sich ihm daher auch zum Zeitpunkt des Ausmarsches in keiner Weise erschloss, war die Dimension dessen was ihn erwarten würde. Denn welche Gefahren es waren, die noch zusätzlich zu den böswilligen Aufrührern auf ihn zukommen sollten, kommt an keiner Stelle in den antiken Schriften klar zum Ausdruck. Das es aber Warnungen über diese zusätzlichen Risiken überhaupt gegeben hat, darf man aus unterschiedlichen Gründen stark bezweifeln. In diesen Zusammenhang gehört auch die Frage, warum sich Paterculus und Tacitus, wenn es um diese unbeweisbare Vorwarnung geht widersprachen ? Nach Paterculus dem Haudegen und Varusverächter soll nun, und das noch bevor sich Florus und Dio über Segestes äußern, zuerst Tacitus das Wort bekommen“. Und da sollte man ihn beim Wort nehmen. In diesem Kapitel wird nun auf einen seltsamen Dissenz aufmerksam gemacht. Nämlich die Abweichung zwischen dem Umfänglicheren was uns Tacitus aus den brisanten Stunden vor der Schlacht hinterließ und dem Minimalen was wir von Paterculus darüber erfahren haben. Im Wesentlichen besteht dieser Dissenz jedoch nur aus einer kleinen fasst unauffälligen dafür aber interessanten Anekdote. Denn während Paterculus über die Warnung im Singular schrieb, also nur von einem einzigen Warnruf von Segestes an Varus wusste, drückt Tacitus dies im Plural, also in der Mehrzahl aus. Wer von beiden hatte recht, warum wichen ihre Informationen voneinander ab und wieso erwähnte Tacitus mehrere Warnrufe und Paterculus nur einen Warnruf. Und nur von Tacitus erfahren wir zudem auch, dass Segestes den Feldherrn sogar noch am Vorabend vor dem Ausmarsch gewarnt haben soll und bekommen in diesem Zusammenhang auch andere Informationen worüber Paterculus schwieg bzw. nicht berichtete. Nämlich das Segestes während des letzten Gastmahls am Vorabend des Abzuges und noch bevor man unter die Waffen trat gesagt haben soll, dass ein Aufstand gegen ihn in Vorbereitung sei. Also ein Aufstand, nicht mehr und nicht weniger, aber das wusste Varus doch schon vor dem letzten Abend nämlich von Arminius persönlich, der ihm dafür sogar seine Unterstützung zugesagt hatte. Segestes konnte Varus was die Aufrührer anbelangte also nichts Neues sagen. Und was Segestes noch gesagt haben soll war, dass der römische Feldherr doch sicherheitshalber Arminius und die übrigen Anführer gefangen nehmen möge, da das germanische Volk nichts mehr unternehmen würde, wenn man ihm die Fürsten nähme. Es wurde damit, wie es recht selten in der antiken Historie der Fall ist, von Tacitus ein temporär exakt fixierbarer Moment beschrieben, zu dem Segestes seine letzte Warnung ausgesprochen haben soll, nämlich der besagte Augenblick am Vorabend des Ausmarsches. Aber Tacitus gab auch Hinweise zu den näheren Umständen, über die uns Paterculus erstaunlicherweise auch nichts sagte. Aber wie stand es um die persönlichen Befindlichkeiten von Paterculus. Denn wenn Paterculus nur von einem „einzigen Warnruf“ sprach, dem wie er ominös schrieb, „AUS ZEITLICHEN GRÜNDEN“ keine weiteren mehr folgen konnten, so drückt dies auch das detaillierte Wissen eines Mannes aus, der die explosive Situation noch zu spüren schien und der davon selbst noch wie betroffen wirkt. Dramatik spricht gewissermaßen aus seiner Überlieferung, so als ob er selbst noch unter dem Eindruck des turbulenten Geschehens von damals stand, obwohl er nicht dabei war, es also nur als unbeteiligter nach etwa 21 Jahren nieder schrieb. Aber auch er hegte keinen, zumindest keinen nach außen hin erkennbaren Zweifel an den Worten von Segestes. So klingt bei Paterculus auch etwas Bestürzung heraus, wie schmal doch damals der Spalt des Zeitfensters war, in den sich die Ereignisse so kurz vor der Niederlage drängten. Aber warum sollte von Segestes an diesem Vorabend überhaupt alles bis auf des Messers Spitze getrieben worden sein. Denn dafür gab es keinen Grund. Denn der Überlieferung nach war Segestes schon lange in die Vorbereitungsphase mit eingebunden gewesen. Warum sollte er sich also, will man Paterculus glauben sich seine einzige Warnung bis zum letzten Abend aufgespart haben und warnte Varus nicht schon viel früher. Denn Segestes wusste doch sicherlich sogar bis ins Detail, was sich über dem Nethetal zusammen braute. Denn er oder Familienmitglieder nahmen doch an den vorbereitenden Versammlungen im Kreise aller Cherusker teil, wo es der Gegenseite sogar gelang ihn letztlich noch mit in den Krieg hinein zu ziehen. Treffen sich hier am Vorabend möglicherweise die beiden Überlieferungen von Tacitus und Paterculus. Dann hätte Segestes, so wie Tacitus es schrieb, weil er es nicht besser wusste an jenem Vorabend seinen letzten Warnruf allerdings einen von mehreren ausgesprochen und nach Paterculus wäre es an diesem Abend zu dem einzigen Warnruf gekommen. Im Gegensatz zu Paterculus berichtete also Tacitus, dass Segestes schon vor dem Vorabend diverse Warnhinweise gegenüber Varus äußerte und dies klingt auch plausibel. Denn warum hätte Segestes es bei nur einer Warnung an Varus belassen sollen und damit sogar noch bis zum letzten aller letzten Moment warten sollen. Man kann sich in Segestes hinein denken wie er 17 + in seiner Argumentationsnot nervös auf dem Verhörstuhl in Rom sitzend gesagt haben könnte “Ich habe doch den Varus noch bis zuletzt gewarnt, aber er wollte ja immer noch nicht auf mich hören, als ich im sagte, dass es für ihn sehr gefährlich werden könnte“. Es macht aber definitiv einen Unterschied, ob es durch Segestes nur zu „einem“ Verrat am eigenen Volke gekommen sein soll, wie Paterculus berichtet, oder ob es „mehrere“ Hinweise auf Verrat von ihm einem Fremdherrscher gegenüber gab, so wie Tacitus es schreibt. Man wird also versuchen die Angaben von Tacitus zu deuten, indem man sie auch noch mit den zwei anderen zur Verfügung stehenden Überlieferungen, aus denen auch Hinweise über das Getane oder eben das Unterlassene des Segestes vorliegen, vergleicht. Denn es folgen auf Paterculus und Tacitus noch die beiden schriftlichen Überlieferungen von Florus und Dio über Segestes und seine Warnung die mit bewertet werden können. Denn immerhin haben sich alle vier antiken Historiker diesbezüglich an Segestes abgearbeitet. Allein daraus spricht schon die immense historische Bedeutung die schon in der Antike dem Verräter Segestes beigemessen wurde und die nur verwundern kann. Vier Historiker die alle mehr oder weniger einen Beitrag zur Varusschlacht beisteuerten, sich aber alle in einem Punkt und das unabhängig voneinander einig waren. Nämlich darin auf keinen Fall auf den germanischen Wortführer Segestes verzichten zu dürfen. Das Verhalten von Segestes muss sie demnach alle enorm fasziniert haben. Oder drückte dies bereits schon Zweifel an ihm aus, dass es auch anders gewesen sein könnte ? Denn noch so viele Wiederholungen des ein und desselben Geschehen oder Gesagten lösen keinen Automatismus hin zu mehr Glaubwürdigkeit aus und erhöhen auch nicht die Zuverlässigkeit von Segestes dem fahnenflüchtigen Strolch. Aber alles was sich aus den Zeilen der alten Historiker, oder zwischen den Zeilen herauslesen lässt, kommt einem Drahtseilakt gleich, möchte man seine eigene Reputation nicht ausreizen und ins phantasievolle abgleiten. Um aber Segestes der dreisten Täuschung, infamen Falschaussage oder geschickten Notlüge zu bezichtigen, ließen sich schon eine Reihe guter Gründe vorweisen. Lässt es also die Stichhaltigkeit der Theorien zu, wähnt man sich der Lösung nahe, oder ist man gar persönlich davon überzeugt, kann man in die zweite Reihe zurück treten, denn man hat das Seine getan, hat etwas zur Erhellung beigetragen und darf mit Interesse die Gegenargumente abwarten. Einige schlüssige Argumente die für diese Theorie der Varusschlacht im Nethegau samt den meines Erachtens nicht vollzogenen Segestes Warnungen sprechen, wurden bereits in den letzten Abschnitten ausgiebig behandelt. So könnte Segestes, der mit seinem Verhalten den Verlauf der Geschichte explizit den der Varusschlacht in der Tat in einem äußerst heiklen Moment ganz entscheidend mit beeinflusst haben. Aber nicht auf die Weise wie man es in den antiken Schriften lesen kann, sondern im Gegenteil, nämlich in dem er sich aus geschwiegen hat, statt Varus auf die reale und größere Gefahr hinzuweisen. Denn die kam nicht von Seiten der Köder also der Aufrührer, sondern wurde ausgelöst von einer Vielzahl von Menschen aus unterschiedlichen Stämmen und Regionen, die sich hier von einer Besatzungsmacht befreien wollten. Denn wenn Segestes vor der Varusschlacht gegenüber Varus im Gegensatz zum herkömmlichen Kenntnisstand keine Warnungen absetzte, so hätte Segestes auch keinen Verrat vollzogen. Varus könnte man dann auch nicht unterstellen er wäre plump, sehenden Auges und im vollen Bewusstsein einer drohenden, da angekündigten Gefahr ins offene Messer gelaufen. Denn in den Hinterhalt lockte man ihn ohne sein Wissen. Genauso so wie es auch alle Quellen übereinstimmend berichten. Aber in eine Falle locken lässt sich bekanntlich nur jemand der ahnungslos ist und nicht jemand den man bereits darauf hingewiesen hat, dass ihm die eigentliche Gefahr schon auf dem Weg in die Falle begegnen sollte. Denn ein Mensch der verlockt wird oder sich verlocken lässt, der weiß auch nichts von einer Warnung. Denn aus der Wortschöpfung „Locken“ spricht immer Unwissenheit und Unkenntnis vor einer konkreten Gefahr. Varus hingegen unterstellte man bekanntlich das krasse Gegenteil, er ließ sich wohlwissend von der Gefahr die ihm schon auf dem Marsch drohte zu den Rebellen ködern. So konnte man ihn für alle Zeiten zum ewigen Sündenbock machen. Diese Kerntheorie beruht jedoch auf der Einschätzung, dass Segestes gegenüber Varus schwieg und ihm das wahre Ausmaß nicht offenbarte. So erscheint vieles, möchte man die Quellen so auslegen plausibler und Varus könnte man somit in weiten Teilen von seinem bitteren Versagerimage frei sprechen. Und es gibt in der Tat einige gewichtige Argumente, dass es sich in der Tat so zugetragen haben könnte. Ein weiteres bietet nun eine Textstudie aus den Annalen des Tacitus. Unter Trajan der von Januar 98 + bis 117 + römischer Kaiser war, stellte der persische Meerbusen die äußerste östliche Grenze des Imperium Romanum dar. Tacitus lebte in dieser Zeit, wusste dies und berichtete auch darüber was den Schluss zulässt, dass in dieser Zeit oder kurz darauf auch seine für die Varusschlacht bedeutsamen Annalen entstanden sein könnten. Allgemein wird daher für seine Niederschrift ein verschwommener Zeitraum zwischen 115 + bis 120 + angenommen. Aber dieser kleine geographische Exkurs soll lediglich verdeutlichen wie weit sich Tacitus, der auf Paterculus folgte schon zeitlich, innerlich aber auch thematisch vom Wesen und vom Inhalt des Geschehens um die Varusschlacht entfernt hatte. Eine große Zeitspanne von über hundert Jahren in der schon vieles an Originalwissen verloren ging und alle Überlebenden der Schlacht bereits seit Jahrzehnten tot waren. In der Zeit in der Tacitus schrieb hatten die Kaiser andere Probleme und Herausforderungen zu bestehen, als einst Augustus. Seine Aufarbeitung entstand im gehörigen Abstand zum Ereignis und er berichtete über eine schon fasst vergessene Zeit für einen überschaubaren Personenkreis, der immer mehr zusammen geschmolzen war. Alles driftete in eine Epoche hinein, die die Schlacht zum unbegreiflichen Trauma werden ließ und von Jahrzehnt zu Jahrzehnt verlor sich mangels Wissen über sie auch das Interesse daran um sich um Erklärungen zu bemühen und sich die Anstrengung der Aufarbeit anzutun. So war es nur einer vom Volke weit entfernten und Hand verlesenen müßigen Oberschicht vergönnt in Momenten dekadenter Endzeitstimmung den alten Faden noch mal aufzunehmen. Bei Tacitus tritt hervor wie wichtig für ihn der Faktor Moral war, wenn er germanisches mit römischem Leben verglich. Was für ihn vielleicht sogar bedeutsamer war, als sein geschichtlicher Nachlass. Für alle Generationen gilt, dass die Geschichte immer da ihren Platz hat, wo sie auch hin gehört, nämlich in die Vergangenheit. Aber Tacitus konnte rückblickend viele Konsequenzen und politische Entwicklungen in seine Betrachtungen mit einbezogen haben, die Paterculus nicht mehr erlebte. Nachdem Tiberius im Jahre 16 + das Ende der Germanenkriege befahl war bis zum Bataveraufstand 69 + die Kriegsgefahr am Niederrhein gebannt. Tacitus blickte auch auf diese Zeit zurück und wusste, wie sich das Verhältnis von Römern und Germanen zwischen Rhein und Weser veränderte, wie sich die Kräfte verschoben und die Grenze am tiberianischen Landlimes zu erstarren begann. Sein rückblickendes Wissen umfasste eine Zeitspanne von rund 100 Jahren. So konnte er auch das triste Ende der einst so Epoche machenden Cherusker, als sie sich noch als ein in sich gefestigter Stamm präsentierten, kommentieren. Es klingt bei Tacitus sogar etwas Wehmut heraus, wenn man sich seine Übersetzung zu Arminius durch liest, die da in etwa lautet: „Er war unbestritten der Befreier Germaniens und hat das römische Volk nicht wie andere Könige und Heerführer in seinen kleinen Anfängen herausgefordert, sondern als das Reich auf dem Höhepunkt seiner Macht stand. In Schlachten war er nicht immer erfolgreich, im Kriege blieb er unbesiegt. Sein Leben währte siebenunddreißig Jahre, zwölf seine Herrschaft. Noch heute besingen ihn die Barbarenstämme“. Und das hätte er demnach in den Jahren zwischen 115 + und 120 + nieder geschrieben. Aber zurück zu den anderen Fakten. Seine Angaben bezieht man sie auf die Örtlichkeit des Saltus ließen sich theoretisch auch auf andere Passwege westlich der Weser in der Nähe germanischer Fliehburgen beziehen, gäbe es da nicht schon einen schlüssigen Kontext auf eine Örtlichkeit, die auf den Koordinaten „9°02'20" E / 51°34'32" N liegt. Aber dann vollzieht Tacitus einen ungewöhnlichen literarischen Sprung in seiner Darstellung. Es liegt uns zwar nur eine Information von ihm vor in der er auf die Warnung des Segestes und das Geschehen vor der Varusschlacht ein ging, aber sie lässt aufhorchen. Die eigentliche Schlacht ließ er bekanntlich völlig unkommentiert und nahm den Faden erst sechs Jahre später wieder auf als Caecina und Germanicus 15 +, wohl an der Spitze der Legionen den Schlachtort aufsuchten. Aber der vermeintliche Warnruf des Segestes noch bevor es zur Schlacht kam, war es ihm doch wert es zu erwähnen. Seit Segestes 17 + in Rom am Triumphzug für Germanicus teil nahm gingen etwa hundert Jahre ins Land bis Tacitus in seinen Annalen schrieb, wie Germanicus im Jahre 15 + die Knochen der getöteten Legionäre beisetzte. Etwa 85 Jahre nach dem Paterculus uns die Information hinterließ, dass Segestes für Varus nur einen einzigen Warner übrig hatte, berichtet uns Tacitus nun aus einer Distanz von rund 100 Jahren eine von Paterculus, dem Zeitzeugen abweichende Darstellung. Zweifellos genießen Überlieferungen die den Ereignissen zeitlich näher stehen, immer einen höheren Wert an Glaubwürdigkeit als jene, die erst 85 Jahre später zu Papier gebracht wurden. Weniger wahrscheinlich dürfte aber sein, dass Tacitus besser informiert war und über weiter gehende Informationen verfügte als Paterculus nur weil er sie zu Papier brachte. Denn mit dem zeitlichen Abstand verringerten sich auch die Quellen. Das augenfällig unterschiedliche zwischen der Überlieferung von Paterculus und der von Tacitus ist die Tatsache, dass wir im Gegensatz zu Paterculus von Tacitus erfahren, Segestes habe den Feldherrn Varus sogar mehrmals gewarnt. Und nicht nur das, er wird sogar noch ausführlicher als Paterculus in dem er schreibt, Segestes habe Varus sogar noch beim letzten gemeinsamen Mal mit den Worten gewarnt. „Arminius turbator Germaniae, Segestes parari rebellionem saepe (oft) alias et supremo convivio“. Aber was sagt uns die Abweichung zwischen der Angabe von Paterculus, der nur von einem einzigen Warner zu berichten wusste und der Aussage des Tacitus, der von oft bzw. mehreren Warnhinweisen sprach. In erster Linie erkennen wir unzweifelhaft, dass unterschiedliche Versionen zum Verhalten von Segestes aus jenen Tagen historisch im Umlauf waren. Aber welche Angabe ist nun die richtige bzw. die glaubwürdigere. Man könnte und sollte ungeachtet späterer Manipulationen an der Segestes Aussage davon ausgehen, dass sich der Wissenstand darüber, was er im vermeintlichen Verhör im Jahre 17 + an Geschichtsträchtigen von sich gab auch in der Folgezeit nicht wesentlich verändert haben dürfte. Seine Darstellung stand fix im Raum und andere Personen außer ihm die man hätte befragen können bietet uns die Historie nicht an. Unter dieser Prämisse betrachtet könnte man dem mehr Glauben schenken, was der den Zeiten näher stehende Paterculus berichten konnte. Tacitus ging auf das Geschehen der Varusschlacht mit keiner Silbe ein. Es drängt sich daher der Verdacht auf, dass er über den Verlauf der Schlacht auch nichts wusste, oder nichts berichten wollte. Was jedoch ins Auge fällt ist ein Hinweis von ihm der erkennen lässt, dass er über einige Ereignisse die sich vor der Schlacht, ereigneten und zwar sogar unmittelbar davor, nämlich am Vorabend bevor man „unter die Waffen trat“ dann doch wieder recht gut informiert gewesen war. Dann aber riss sein Interesse ab, der Nachwelt mehr hinterlassen zu wollen. Segestes stellte, möchte man die Angaben von Tacitus in der Gestalt interpretieren den Sachverhalt im Jahre 17 + so dar, als ob er sich erst nach dem seine Warnungen bei Varus auf taube Ohren stießen förmlich gezwungen sah nun gemeinsam mit Arminius geradezu an der Schlacht teilnehmen zu müssen. Obwohl er dies nicht beabsichtigt hatte. Demnach war es der Vorabend als es zum besagten letzten Warnruf kam und dies war dann möglicherweise auch der einzige Warnruf, so wie es auch Paterculus hinterließ, weil er näher am Geschehen lebte. Was Tacitus letztlich veranlasste von mehreren Warnrufen zu schreiben bleibt offen. Segestes könnte auch einen einmalig statt gefundenen Warnruf dem römischen Tribunal gegenüber plausibel dargelegt haben. Segestes argumentierte es in dergestalt, als dass Varus durch sein schroffes und abweisendes Verhalten indirekt auch seine Teilnahme am Kampfgeschehen erzwang. Ein Argument mit dem es sich auch gut aus aller Verantwortung heraus reden ließ. Im Zuge seines ihm durch Varus entgegen gebrachten Misstrauens forderte dieser es nahezu heraus. Segestes konnte sich Achsel zuckend und unschuldig zurück lehnend dem Tribunal sozusagen selbstredend als Opfer der Situation präsentieren und alles wirkte stimmig. Nach dem Varus ihn also brüskierte in dem er ihm keinen Glauben schenkte, sah Segestes auch keine Veranlassung mehr, sich an der Schlacht nicht zu beteiligen um dann irgendwo in rückwärtiger Stellung den Ausgang abzuwarten. Er hatte seinen Beitrag geleistet. Eine Handlungsweise die auch für die interessierte Fragerunde im Palatin im Jahre 17 + nachvollziehbar erschien, da sie ihm glauben wollte vor allem aufgrund höherer Direktive auch musste. Schlussfolgerung. Auch Tacitus war zum Zeitpunkt der Niederschrift seiner Annalen nicht bekannt, dass die Äußerungen von Segestes 17 + möglicherweise nur auf Schutzbehauptungen beruhten, er hielt dass, was ihm an schriftlichen Zeugnissen zur Verfügung stand für korrekt und es klang für ihn authentisch. Aber entnahm Tacitus seinen Wissensstand wirklich einer Quelle, die nicht identisch war mit der über die Paterculus verfügte bzw. gab es diese überhaupt. Man darf annehmen, dass wie Paterculus auch Tacitus Kenntnis über die Aussagen des Segestes hatte und mit Paterculus in etwa auf gleichen Wissenstand war. Aber die Anzahl der Warnrufe macht den kleinen Unterschied zwischen beiden Überlieferungen und für diese Differenz gilt es eine Erklärung zu finden. Daher die Frage, ob es gegenüber Paterculus abweichende Quellen gab, Zwischenquellen, die es Tacitus gestattet hätten anderes zu berichten als Paterculus. So darf man sich mit der hypothetischen Frage auseinander setzen, wem im römischen Herrscherhaus noch daran gelegen sein könnte und ob überhaupt ein Interesse daran bestand, nach dem Jahr 30 + in dem Paterculus schrieb das Kapitel Varusschlacht noch einmal aufzugreifen, es fort zu schreiben um es durch ergänzende spätere Berichte zu komplettieren. Tiberius regierte bis 37 + und nach ihm regierten bis in die Zeit in der Tacitus seine Annalen veröffentlichte weitere immerhin etwa 22 römische Kaiser. Neue Enthüllungen zur Varusschlacht in diesen Jahren dürfte es wohl über die gesamte Zeit betrachtet nicht mehr gegeben haben. So wird mit Paterculus die geschichtliche Quellensichtung zur Schlacht auch ihr vorläufiges Ende gefunden haben. Demnach zu urteilen könnte man annehmen, dass sich alle Historiker nach Paterculus an dem Wissensstand abgearbeitet haben dürften, wie er bis zu diesem Zeitpunkt also dem Jahr 30 + hinterlegt war. Man könnte möglicherweise sogar so weit gehen zu behaupten das auch das, was viele Jahre später Cassius Dio niederschrieb, schon dem Wissenstand entsprach den Paterculus besaß, der aber nicht darüber berichtete. Es nicht verschriftete, da sein Interesse am Untergang seines möglichen Rivalen um die Statthalterschaft in Germanien, nämlich Varus nur mäßig vorhanden war. Möglicherweise hätte er noch über Abläufe berichten müssen, die Varus sogar noch in ein besseres Licht hätten rücken können. Denn es scheint nahezu unvorstellbar das verspätet, also noch nach 30 + eingegangene Zeitzeugenberichte noch von einem akribischen Bibliothekar nachträglich den alten Senatsakten angeheftet worden wären, selbst wenn es sie gegeben hätte. Was auf dem Tisch lag, das lag bis 30 + auf ihm und über 21 Jahre nach der Schlacht verspürte niemand mehr ein Interesse Details über eine verlorene Schlacht zu erfahren. Es gab niemanden mehr den man hätte zur Rechenschaft ziehen können oder wollen und über Niederlagen sprach und referierte man nicht gerne. Da sich schulischer Lehrstoff daraus auch nicht gewinnen ließ, könnte das Wissen um den Schlachtverlauf nur in römischen Militärakademien oder ähnlichen Institutionen auf Interesse gestoßen sein, die es jedoch im Imperium nicht gab. So kann angenommen werden, dass mit dem Jahr 30 + auch jegliche Auf- und Nachbearbeitung aller bis dato bekannten Informationen zur Varusschlacht zum Abschluss gekommen sind und die Akten geschlossen wurden. Und auch ein Florus wusste nicht mehr als das, was schon Paterculus bekannt wurde bzw. ihm schon bekannt war. Nach allem was Tacitus einsah oder meinte beurteilen zu können, wollte er Segestes über jeden Zweifel erhaben machen, steigerte sich in der Begrifflichkeit und wollte möglicherweise die Plausibilität damit stärken, in dem er aus dem einmaligen Warnruf, je nach Übersetzung sein „oft“ oder „mehrfach“ bekräftigte. Tacitus wähnte sich in den Fußstapfen von Paterculus der ähnlich schrieb und ihm könnte daran gelegen gewesen sein, der Aussage von Segestes ein Mehr an Gewicht und Glaubwürdigkeit zu verleihen und unterstrich dies mit dem Hinweis auf mehrere ergangene Warnungen. Somit beteiligte er sich mit einer kleinen Randbemerkung aktiv an der möglichen Legendenbildung des doch so treuen Segestes der letztlich aus sich selbst seine ureigene Quelle machte. Auch hier schimmert wieder der Wunsch nach Eigeninterpretation durch, die einem Paterculus weniger zu Gesicht stand, dieses mal aus der Feder von Tacitus. Die aber wiederum Paterculus glaubwürdiger erscheinen lässt. Denn um so häufiger Segestes Varus warnte, um so mehr ließ sich sich Varus zu einem völlig unbelehrbaren Feldherr abstempeln, der in Gänze fehl am Platz war. Tacitus übernahm damit im Kern die Darstellung wie sie bereits bei Paterculus zum Ausdruck kam. Denn auch Paterculus erklärte Varus zum Alleinschuldigen und Tacitus tat es ihm gleich. Und desto mehr man Varus damals noch unter Tiberius ins schlechte Licht rückte, um so besser war es für das Image des Kaiserhauses. Um so hilfreicher waren auch die Angaben und Aussagen von Segestes um vom gesamten militärischen Versagen und den Versäumnissen vor und während der Varusschlacht abzulenken. Denn die Legionen wollte und musste man sauber halten, sie waren eine Macht im Staate und entschieden kraft ihres militärischen Gewichtes auch über wohl und wehe des Kaisers bis hin zu seiner Absetzung. Und das galt auch noch für die Zeit in der Tacitus schrieb. Man könnte aufgrund der dargestellten Abweichung zwischen Paterculus und Tacitus auch an eine frühe Quellenverfälschung schon im Verhörsaal des Kaisers denken, der bereits Paterculus zum Opfer gefallen sein könnte. So könnten die Angaben von Segestes auch schon im Jahr 17 + zum Spielball politischer Auslegungen, Ränken und Interessen im Sinne der vorherrschenden Politik geworden sein oder die Protokolle enthielten einen irreführenden Satzaufbau der falsche Interpretationen zuließ. So ließe sich daraus schlussfolgern, dass das Kaiserhaus sich der Brisanz der Segestes Aussagen durchaus bewusst war und sie sich nutzen ließen um das Kapitel Varusschlacht damit innenpolitisch zum Abschluss zu bringen. Weitere spätere Vervollständigungen die der Aufhellung hätten dienen können waren nicht mehr gewünscht. So könnten auch Unterlagen die sich noch in der Palatinischen Bibliothek befanden schon zu Zeiten von Tiberius gezielt separiert bzw. aussortiert worden sein um auch an seiner Person keinen Makel entstehen zu lassen. Tacitus durfte und konnte sich also den Details zur eigentlichen Varusschlacht nicht mehr widmen, weil diese Quellen auch wenn sie noch existierten, nicht mehr auffindbar oder zugänglich waren. Man kann zudem nicht ausschließen, dass möglicherweise sogar einiges vernichtet, oder gar nicht erst im Protokoll festgehalten wurde. Es könnten aber auch Berichte existiert haben, die zu den Zeiten von Tacitus noch unter Verschluss lagen und erst von Cassius Dio genutzt werden konnten, denn es will nicht zu Tacitus passen, dass dieser das Kapitel Varusschlacht komplett ausklammerte, wenn er denn Details gewusst hätte. Was Tacitus zu Augen kam, darüber berichtete er und brachte es zu Papier, andere Quellen konnte er nicht erreichen. Hätte er Unterlagen vorgefunden, hätte man dies als späte Kritik an Tiberius wegen seiner Germanenpolitik auslegen können, das vermied möglicherweise schon frühzeitig der Kaiser. Aber warum Paterculus kein Wort über das Gastmahl am Vorabend und über den Vorschlag man könne doch die Fürsten gefangen nehmen verlor, so wie es Tacitus im Abschnitt 1,55 (2) hinterließ, lässt andere Gedankengänge zu. Einer davon könnte sich auf Paterculus den Militaristen beziehen, dem das Lagerleben verpönt war. Er verachtete daher das Verhalten von Varus, da der den bequemen Aufenthalt gegenüber einem aufreibenden Sommerfeldzug bevorzugte. Damit ließe sich erklären, warum Paterculus sich eine Bemerkung über den illustren Abend samt Gaumenfreuden ersparte. Aber was hinderte Paterculus daran auf die Idee von Segestes einzugehen, die höher gestellten Germanen in Haft nehmen zu lassen. Denkbar ist grundsätzlich, dass Paterculus nicht auf jedes Detail einging. Er also nicht alles aus den Gesprächen zwischen Segestes und den Staatsbeamten in Rom für sein Geschichtswerk übernahm und nutzte, obwohl ihm vieles daraus bekannt gewesen sein dürfte. Paterculus wusste auch was sich in der Burg des Segestes 15 + zutrug, als sich dieser von Germanicus retten ließ. Und auch über Germanicus hätte er mehr schreiben können, der ihm aber nicht viele Zeilen wert war, da er von seinen unrühmlichen militärischen Defiziten im Pannonienkrieg wusste und wie unzufrieden Kaiser Augustus deswegen mit ihm war. So blieben für Tacitus noch diverse Begebenheiten die dieser in seinen Annalen verarbeiten konnte. Detailreiches Wissen über die Ergebnisse des Verhörs mit Segestes, dass Tacitus den Protokollen entnahm erfahren wir folglich erst rund 100 Jahre nach Paterculus. Den nur vermeintlich guten Schachzug die Fürsten in Fesseln legen zu lassen stufte der erfahrene Paterculus als Kenner der Umstände möglicherweise auch als grotesk bis lächerlich ein und unterließ es daher es zu zitieren. In einem früheren Kapitel wurden die Gründe dafür bereits ausführlich dargelegt. Der unverkennbare Disenz der Warnrufe aus den zwei Quellen erlaubt einen Blick in das Wesen antiker Geschichtsschreibung schlechthin. In diesem Punkt unterscheidet es sich auch nur wenig von der modernen Vorgehensweise die auch aus dieser Erfahrung heraus soviel wert auf einen korrekten Quellennachweis legt. Allerdings nur wenn man über eine Internationale Standardbuchnummer veröffentlichen, sich also vermarkten möchte. So ist auch hier die Erklärung so einfach wie simpel. Denn auch Tacitus konnte keine neuen Quellen mehr auftun, die ihm anderes verraten hätten. Da es sie nicht gab, musste er sich auf die eine Urquelle beschränken und sich mit ihr begnügen aus der sie alle schöpften. Das sich nach etwa einhundert Jahren kleine Unterschiede in der Bewertung und Auslegung einschlichen ist nachvollziehbar. Das es wie in diesem Fall nur minimale Nuancen und keine Grundsätzlichkeiten sind, bestätigt zudem die Glaubwürdigkeit der Urquelle nämlich der immer wieder kehrende Verweis auf Segestes bzw. seine Behauptung. Diese Tatsache ist daher von weitaus größerer Bedeutung, als das was Tacitus später aus den Worten seines Vorgängers Paterculus machte, nur weil ihm ein Warnruf zu wenig erschien. Und wer will schon seinen Kopf dafür hinhalten, dass es nicht auch einen unentdeckten Bericht von Paterculus gab in dem er selbst von mehreren Warnrufen sprach. Mangels Wissen gehorcht und unterliegt es einer kaum vermeidbaren Zwangsläufigkeit, dass der Jüngere unausweichlich vom Älteren abschrieb und es daher ungeprüft übernehmen muss, weil er keine andere Wahl hat. Es spiegelt wider, wie sich eine einmal aufgestellte Behauptung ausbreiten kann und wofür die Historie viele Beispiele kennt. In diesem Fall führte es zu der möglicherweise irrigen Annahme, dass es beinahe einem Mann möglich gewesen wäre, eine ganze Schlacht mit tausenden von Toten verhindern zu können. (20.01.2021)
... link
Montag, 4. Januar 2021
Ostwestfalen - Südwestengland
ulrich leyhe, 00:56h
Nicht nur die Heraldik verbindet die Regionen.
Möchte man sich auf die Suche nach dem Grab von Varus begeben ist allerdings ein unerwarteter Umweg nicht zu vermeiden.

Das Ross der Westfalen
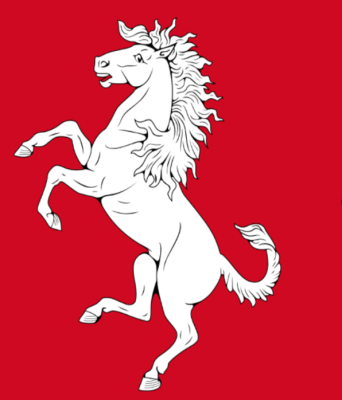
Das Ross der Angelsachsen in der Grafschaft Kent
Möchte man sich auf die Suche nach dem Grab von Varus begeben ist allerdings ein unerwarteter Umweg nicht zu vermeiden.

Das Ross der Westfalen
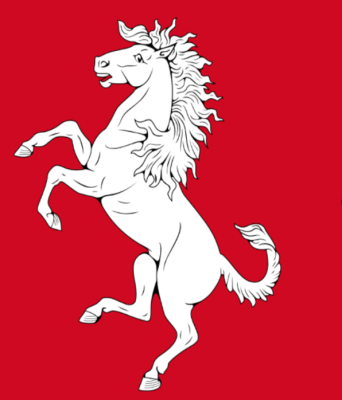
Das Ross der Angelsachsen in der Grafschaft Kent
... link
Samstag, 26. Dezember 2020
Tacitus der Vorabend der Schlacht und die Frage der Deutungshoheit
ulrich leyhe, 15:59h
Da sich weder den textuellen Inhalten noch dem Stil der Formulierungen den die antiken Historiker im Zusammenhang mit der Varusschlacht wählten Rückschlüsse auf ihre wahre Gesinnung, ihre Absichten und ihre tieferen Gefühlswelten entnehmen lassen, erübrigen sich auch umfangreiche Charakterstudien über sie, was die Analyse ihrer Überlieferungen erschwert. Aber das mag Ansichtssache sein. Tacitus bildet da keine Ausnahme aber trotzdem ist er unter ihnen seit jeher die strahlende Eminenz und seine Worte genossen immer schon einen hohen Stellenwert. Während er uns kein Sterbenswort über den Verlauf der Schlacht hinterließ, so verdanken wir doch nur ihm unser Wissen darüber, wo sich seinerzeit der Zenit der Schlacht befand. Eine Gebirgsschlucht in der Nähe germanischer Volksburgen. Aber Segestes Unhold und Synonym für das Unmoralische im Menschen zugleich, findet auch bei ihm Erwähnung. So spricht er über ihn in der wohl unübersichtlichsten Phase die man sich eigentlich nur vorstellen kann, nämlich über das Geschehen am letzten Abend vor dem Ausmarsch der Legionen aus dem Sommerlager. Durchleben wir die taciteische Darstellung mit, dann müsste die Atmosphäre an diesem Abend bei Varus in seiner Kommandantur oder seinem Bankettsaal spürbar geknistert haben und das sich den Anwesenden bietende Schauspiel ließ sich demnach an Brisanz kaum mehr steigern. Es sollte allen wie ein traditionelles Zusammentreffen erscheinen zu dem Varus an diesem Abend einlud, könnte aber angesichts der Marschrichtung und dem Bevorstehenden einer Einberufung näher gekommen sein. Ein bedeutsamer zeremonieller Schlusspunkt, den man an das Ende eines monatelangen Zusammenwirkens setzte, der aber an diesem Abend überschattet wurde. Man ging am Folgetag auseinander, denn über die Wintermonate werden die Kontakte von Ostwestfalen an den Rhein, wenn es sie denn überhaupt gab, relativ rar gewesen sein. Varus wird nur jene germanischen Großen in den Kreis einbezogen haben, denen er diese Ehre zuteil lassen wollte und die strategisch für ihn wichtig waren. Über ihre Anzahl und Zusammensetzung lässt sich rätseln und auch darüber ob Cherusker aus dem Hause Segimer oder anderer Stämme daran teil nahmen. Aber man darf annehmen, dass der gewichtige aber zugleich unzufriedene Flügel der Cherusker daran teil nahm, denn sie durften nicht fehlen. Eine Absage hätte Varus zudem als unhöflich oder sogar als einen Affront werten können und am nächsten Morgen wollte man schließlich gemeinsam ausrücken. Da auch Cassius Dio bestätigte, dass sich Arminius und Segimer stets in der Nähe von Varus aufhielten und sie oft zu seinen Gästen zählten, wird er sie sicherlich ebenfalls zum letzten Gastmahl eingeladen haben. So begegneten sich Segestes und Arminius sogar noch während des Gastmahls am Vorabend vor dem Abzug. Der Gesprächsinhalt wird neben gegenseitigen Loyalitätsbekundungen auch aus ernsten Themen bestanden haben, so versicherte man sich der Unterstützung und stieß darauf an. Und an diesem Abend inmitten dieser illustren Runde soll also auch Segestes gesessen haben um alles auffliegen zu lassen. Und spätestens jetzt wäre der Moment gekommen in dem der Leser seine gesamte geschärfte Vorstellungskraft aufbringen muss. Denn nun müsste er sich kognitiv in das unmittelbare Geschehen hinein denken und sich selbst einen Platz am großen Tisch suchen, von wo aus er mit erleben kann, wie es damals zuging. Unter der Voraussetzung betrachtet, dass jeder anwesende Germane Kenntnis vom Komplott gehabt haben dürfte, war die Zusammenkunft was den heuchlerischen Aspekt anbelangte nicht mehr zu überbieten. War man Germane, dann frohlockte man still vor sich hin, ohne sich was anmerken zu lassen, war man Römer dann mag dem einen oder anderen die Stimmung etwas seltsam vorgekommen sein. Selbst die hartgesottensten Anführer aus der Segimer Sippe werden versucht haben frühzeitig dieser Atmosphäre zu entgehen, um die gemeinsame Sache schlussendlich nicht doch noch durch unbedachtsame Äußerungen oder Verhalten zu gefährden. Mit Hinweis auf den folgenden anstrengenden Tag „für alle“, dürfte sich der Abend nicht lange hingezogen haben. Sollte Segestes gegenüber Rom „eine ehrliche Haut“ gewesen sein, er also nicht gelogen haben sollte und seinen Verrat wie dargestellt beging, dann wird er vor dem Beginn des Zusammentreffens und vor dem Erscheinen der gegnerischen Fraktion, seine Sorgen Varus gegenüber noch nicht kund getan haben. Denn mit dem Eintreffen der Segimer Cherusker wäre die unmittelbare Gefahr eines Eklats gegeben und erst recht nach deren Ankunft. Wann also sollte oder wollte Segestes denn Zeitpunkt und die Gelegenheit gefunden haben Varus zu warnen. So hätte bei genauem Hinsehen an diesem Abend auch die Stunde der Wahrheit schlagen müssen. Denn ein Segestes der vor versammelter Mannschaft aller Germanen urplötzlich die heimtückischen Pläne und hinterlistigen Absichten der Gegenseite auf den Tisch gelegt hätte wäre nicht so zu Ende gegangen wie es uns Tacitus beschrieb. Denn unter diesen Umständen wäre man nicht gemeinsam nach dem Gastmahl unter die Waffen getreten bzw. hätte sie für den nächsten Tag an sich genommen. Dieser Verrat hätte einen offenen Gewaltausbruch zur Folge gehabt. Die Segimer Männer hätten umgehend zur Waffe gegriffen und genauso hätte Segestes samt Anhang sofort die Schwerter gezückt. In diesem Moment wäre kein Platz mehr für Taktik oder Diplomatie gleich welcher Art gewesen. Denn jedes andere Verhalten von Seiten der Segimer Sippe auf diese brüske Anschuldigung hin, hätte für Varus wie ein Eingeständnis des Vorwurfs von Segestes ausgesehen. Segimer hätte nicht anders gekonnt, obwohl er und damit auch Arminius den Plan zunichte gemacht hätten. Allein aus Gründen der Ehrenrettung ließ es sich nicht vermeiden. Und nicht vergessen wir bewegen uns hier in archaischen Zeiten und nicht auf einem Parkett samt geschliffenem Diplomatendeutsch. Man könnte sich den Verrat lediglich auf einem unteren Niveau vorstellen, dass also Segestes nur andeutet haben könnte, Varus solle die Rebellen nicht allzu leicht nehmen. Was allerdings noch kein Verrat gewesen wäre. Wenn also Segestes diese Warnung überhaupt aussprach, dann nur bei Abwesenheit der übrigen Germanen und wohl auch nur im diskreten persönlichen Zwiegespräch ohne andere römische Offiziere möglicherweise am Ende der Veranstaltung. Demnach blieb der Verrat, hätte es ihn denn gegeben auch ohne Zeugen, die es an Segimer hätten weiter tragen können. Es lässt sich daraus entnehmen wie künstlich, nahezu konstruiert bzw. an den Haaren herbei gezogen der gesamte Akt des Verrates auf uns heute wirken muss und auch nur deshalb funktionieren konnte, weil es dafür 17 + in Rom keine Zeitzeugen mehr gab, die es anders hätten berichten können. Und Tacitus kommentierte das Geschehen mangels besseren Wissens mit den mageren Worten, dass man unmittelbar danach unter die Waffen trat, auch recht kurz angebunden. Man sollte darin nicht mehr und nicht weniger einen völlig normalen Akt sehen, der sich im Zuge der nötigen Vorbereitungen des Ausmarsches routinemäßig vollzog. Ohne Hektik aber auch ohne Verrat. Denn das Bereitlegen der Waffen für den folgenden Tag gehörte zur standardisierten Vorgehensweise auch dann, wenn man keinen Rebellen einen Besuch abstatten wollte. Das Tacitus es besonders betonte also erwähnte könnte lediglich ein Hinweis darauf gewesen sein, dass man mit einem begrenzten aber alles in allem doch beherrschbaren Konflikt zu rechnen hatte der auch einen Waffeneinsatz nicht völlig ausschloss. Denn das war hinreichend bekannt, war möglich und schließlich auch mit ein Grund und Zweck des Abstechers zu den Aufrührern. Und für diese Vorgehensweise bedurfte es auch keiner besonderen Warnung bzw. Erwähnung durch Segestes. Dies alles gilt jedoch nur dann, wenn es so war wie Tacitus es schrieb. Denn bis heute können wir nicht mit Bestimmtheit sagen, ob es sich auch so zutrug, wir können es wie vieles andere auch, nur glauben und vorsichtig rekonstruieren. Wir können nach gutem Glauben und etwas angebrachter Skepsis noch nicht einmal davon ausgehen, dass es überhaupt zu einem Gastmahl am Abend vor dem Ausmarsch kam. Denn selbst diese Darstellung könnte schon zum rhetorischen Bestandteil im kleinen „Schauprozess“ aus dem Munde von Segestes, vor den Beamten des Palatin gezählt haben. Denn wir wissen, dass sich außer Tacitus kein anderer Historiker zu diesen Vorgängen am besagten Abend geäußert hat und auch nur einer nämlich Segestes für die Darstellung dieser Vorabend Szenerie infrage kommt. Andere Germanen überlebten den Abend auch, setzten aber ihren Fuß nie auf die Straßen von Rom. Dies macht zweifellos die Suche nach der Wahrheit problematisch. Von Bedeutung ist zudem, ob Segestes seine Sorgen Varus gegenüber nur im persönlichen Zwiegespräch zum Ausdruck brachte, oder ob es zum Dialog kam, es also weitere Zeugen für seine Warnung gab. War es nur ein unbewiesener Monolog zwischen Varus und Segestes, so lässt dies in jedem Fall Zweifel am überlieferten Sachverhalt zu. Das Tacitus an keiner Stelle die Namen von Personen, denen er sein Wissen über die Vorgänge an jenem denkwürdigen Vorabend verdankte erwähnte mag zeitgemäß gewesen sein, lässt seine Überlieferung aber ebenfalls fragwürdig erscheinen. Der besagte Abend fiel dieser Theorie nach auf den 23.9.0009. Am Vormittag des 24.9.0009 setzte sich der Zug träge in Bewegung, man verließ das befestigte Kastell, übergab es dem „Schutz der Wesergermanen“ und begab sich auf den Weg ins erste Marschlager Brakel. Von dort aus brachen am 25.09.0009 nun zwei getrennte Marschzüge auf. Einer zu den Rebellen und einer auf direktem Weg nach Anreppen. Im weiteren Verlauf etwa gegen Mittag setzten unter wetterwendischen Bedingungen die ersten noch verhaltend vorgetragenen Störungsversuche von germanischer Seite auf die bewaffnete Kolonne ein. Es waren danach zu urteilen am Vorabend die alles entscheidenden Momente gewesen, in denen Segestes seine warnenden Worte gegenüber Varus ausgesprochen haben will. Augenblicke aus denen man herauslesen sollte, dass jetzt noch die letzte Möglichkeit bestanden haben könnte, dass sich also das Steuer kurz vor dem Untergang noch einmal hätte herum reißen lassen können. Ganz so, wie es der geschickte Plan von Segestes vorsah und wie er wollte, dass man es auch so in Rom auffassen sollte. Da sich aus dem Teilnehmerkreis dieser möglicherweise „feucht fröhlichen“ Gelage ähnliche Stimmung nur ein Überlebender später in Rom befragen ließ, konnte Tacitus sein Wissen von keiner anderen Person gehabt haben. So wird er es nur den späteren Aufzeichnungen aus der Hand der römischer Staatsbeamten entnommen haben, die mit Segestes 17 + in Rom die Ereignisse durch sprachen, um mal die Redewendung Verhör zu vermeiden. Ob sie auf dem langen Weg zu Tacitus auch noch durch andere, möglicherweise auch verfälschende Hände gingen, bleibt genauso unbekannt. Paterculus kam Tacitus zeithistorisch noch zuvor, denn er widmete sich als der erste Historiker überhaupt, und das schon 21 Jahre nach der Varusschlacht um 30 + der Person des Segestes. Aber im Gegensatz zu Tacitus berichtete er nichts über die vorabendlichen Gespräche. Aber Paterculus könnte Segestes sogar noch persönlich gesprochen haben und war nicht auf die alten Gesprächsprotokolle angewiesen wie Tacitus, der es darauf basierend erst über 100 Jahre nach der Schlacht nieder schrieb. Das lässt ihn gegenüber Tacitus authentischer wirken. Segestes betrat in Rom vermutlich im Frühjahr 17 + die Bühne als einziger Gewährsmann für all das, was sich kurz vor der Schlacht in Ostwestfalen zutrug. Segestes der allseits gefragte Platzhirsch, den er aber nur solange verkörperte, wie über ihm der Schutzschirm des Kaisers schwebte. Was verwundert ist aber die Feststellung, dass sich Tacitus kein einziges Mal in seinen Annalen auf den bedeutsamen Paterculus stützte, ihn weder erwähnte noch seinen Namen fallen ließ. So als ob er ihn gar nicht gekannt hätte, ihn mied, ignorierte oder auf ihn verzichten konnte, weil er wollte. Aber er musste Paterculus gekannt haben, denn er war der erste Historiker, der sich noch vor ihm über Segestes äußerte und er war eine Persönlichkeit über die sich auch ein Tacitus nicht hinweg setzen konnte, wenn dieser historisch ernsthaft Zeugnis von der Varusschlacht ablegen wollte. Suchen wir nach Gründen, so könnten seine Aufzeichnungen möglicherweise auch nicht in seine Hände gelangt sein oder er distanzierte sich bewusst von seinen Berichten, da er das unabhängige vielleicht auch neutrale Quellenstudium bevorzugte. Vergessen wir nicht, dass Paterculus, dass Militärische anhaftete. Es könnte Tacitus dazu bewogen haben Abstand von seiner Art der Darstellung zu nehmen. Dennoch könnte Tacitus Einblick in das genommen haben, was vor ihm Paterculus nieder schrieb auch ohne das er ihn als Quelle nannte. Mündliche Originalüberlieferungen blieben Tacitus naturgemäß verwehrt, so konnte er nur auf das uns unbekannte, also auf anonyme Zwischenquellen aus zweiter Hand Zugriff genommen haben, die auf Basis der Segestes Aussagen nieder geschrieben wurden. Woher er sein Wissen letztlich hatte werden wir nie erfahren. Trotzdem bleibt die Frage ungeklärt, ob Paterculus möglicherweise doch mehr über die letzten Stunden vor der Schlacht erfahren haben könnte, mehr noch als das was wir über Tacitus erfuhren. Denn das Tacitus mehr über das Verhalten des Segestes zu Papier brachte als Paterculus, lässt sich nach lesen. Und auch immer wird es einen Unterschied zwischen dem geben was man weiß und dem was man später nieder schreibt. Aber auch für das was Tacitus schriftlich hinterließ gilt der Spruch „Es ist alles nur eine Frage der Interpretation“ und damit ließe sich vieles von alledem abtun, was uns alle großen Geister der Antike zur Varusschlacht hinterließen. Es lässt sich also so manches mit Leichtigkeit auch in seiner Aussagekraft relativieren, wenn es sich nicht so recht unserem Vorstellungsvermögen fügen möchte, weil wir vorgefasste Ansichten vertreten möchten. Aber es kommt einer Pflicht gleich es auch interpretieren zu müssen, denn die jeweilige auch unterschiedliche Auslegung entscheidet mit über das, was wir Geschichte nennen. Und was sollen und können wir überhaupt mit schriftlichen Aufzeichnungen anfangen, wenn wir dem, oder den Menschen die es seinerzeit verfassten dabei nicht mehr in die Augen sehen können und nicht ihre Absichten und Beweggründe erkennen die dahinter standen und sie einst zu dieser oder jener Bemerkung verleiteten. Konfrontiert man sich mit dieser Frage dann gerät auch der beste Geschichtsforscher schnell an den Rand seiner Fähigkeiten, denn Snorris Schwarzalben lauern hinter jedem Stein und lassen grüßen. Wem können wir und was können wir glauben, wenn uns uralte Papiere vorgelegt werden und was trägt die Forschung zu des Rätsels Lösung bei, von denen es viele gibt. Daher zuvor noch eine Betrachtung zu Fragen betreffend der allgemeinen Deutungshoheit. Man ist gewohnt, es im vollen Vertrauen den Fachleuten zu überlassen und zu ihnen aufzublicken. Zweifellos darf sich aber dennoch jeder nach Belieben und nach seiner Fasson daran beteiligen, denn es bestehen keine Einschränkungen, erhobene Zeigefinger oder Tabubereiche. Gelehrte einschlägig geschulter Fachbereiche sind in der Regel belesener, somit breiter aufgestellt und daher bevorteilt, wenn sie sich anstrengen die alten Schriften zu bewerten und zu deuten. Dank eines umfangreichen Schriftentausches und professioneller Qualifikation haben sie viele Schritte gegenüber den interessierten Laien voraus. Für die weniger versierten Freunde der Geschichte kommt noch erschwerend hinzu, dass viele wissenschaftliche Arbeiten der Öffentlichkeit gar nicht erst zugänglich gemacht werden und so bleibt es ein ungleiches Rennen. Aber trotzdem wird überall nur mit Wasser gekocht, es bleiben Nischen die gefüllt sein wollen und selbst das ausgefeilteste Vokabular unter Ausschöpfung maximaler Wort Akrobatik aus Expertenhand ist kein Garant für Erkenntnisgewinn. Die Voraussetzung für substanzielles Hinterfragen, dass uns letztlich weiter bringen soll und was auch das Recht des generellen infrage Stellens alter Texte mit einschließt, ist immer die Schaffung eines soliden Fundaments. Es sollte so weit wie möglich aus ausgewogenen, glaubhaften und plausiblen Annahmen resultierend aus diversen Vergleichen und umfassendem Kenntnisstand bestehen. Vor allem aber sollte es Mental den alten Zeiten und Denkweisen aus den zwei gegensätzlichen Kulturkreisen gerecht werden denen sie entstammten und die es sich zu verinnerlichen gilt. Denn ein u.a. etruskisch und griechisch beeinflusstes römisches Imperium in einer mediterran geprägten Welt hatte nichts mit einem abgeschiedenen Germanentum gemein, das südlich der Mittelgebirgskette auch immer noch den Einflüssen diverser Keltenstämme ausgesetzt war. Völker mit denen man je nach Gesinnung mal gut und mal schlecht zusammen lebte, mit denen man im Austausch stand, die aber auch eine Pufferzone und trennende Zivilisation zwischen ihnen und den römischen Eroberern bildeten. Kommt die nötige Sensibilität gegenüber dem kargen Alltagsleben unserer Vorfahren zu kurz, dann werden viele mit geistiger Mühe und Vorarbeit zu Papier gebrachten Analysen ihr Versprechen nicht halten können und in ihrer Aussage mittelmäßig bleiben. Denn alles sollte beim Leser mehr hinterlassen als den seichten Eindruck nur den bloßen Tatbestand einer erneuten Publikation erfüllt zu haben. Nur aus einem inneren Anspruch heraus wieder einmal publizieren zu müssen, sollte nicht zur Antriebsfeder geschichtlicher Aufarbeit werden. Sieht man es nicht schon so manch wissenschaftlicher Abhandlung gleich welcher Disziplin an, wenn sich selbst die umfangreichsten Aufsätze in einem Fazit zusammen fassen lassen, das dann frei nach dem Motto „Im Westen nichts Neues“ nur aus wenigen Zeilen besteht. Die Essenz sollte nach Möglichkeit auch das Interesse am Gesamtwerk wecken und nicht zum Ziel haben, es zunichte zu machen. Zusammenfassungen verleiten zu Bequemlichkeit und beherbergen die latente Gefahr, dass man aufgrund der Fülle von Schriften sein Wissen nur noch aus dem Fazitären schöpft und das Hauptwerk ignoriert. Denn was der Tierschutzpraktiker Bernhard Grzimek einst über die Natur sagte, gilt auch für die Historie. Auch sie lässt sich wie manche Prozesse in der Natur auch, zu Tode erforschen ohne das sie in nutzbare Sinnhaftigkeit münden. So sind für das Aufstellen guter Theorien auch schon mal jene freiheitlichen und intuitiven Qualitäten gefragt, die nicht an den Hochschulen erlernbar sind. Wirft man allein einen Blick auf die von Experten viel zitierten zahlreichen Theorien zum möglichen Verlauf oder den eventuellen Örtlichkeiten der Varusschlacht, so erkennt man auch derartige Versäumnisse in der Forschungslandschaft. Wer auch immer sie gezählt haben will, sie sind über die Jahrhunderte betrachtet auf über 750 angeschwollen und so wäre hier dringend ein Schnitt nötig. Denn es ist an der Zeit diese unübersichtliche Fülle einzukürzen, sie neu zu ordnen und anders zu strukturieren um die Gemeinde der Interessierten damit nicht unnötig zu irritieren und ihnen die Motivation zu rauben. Denn nahezu alle Hypothesen die aus der Zeit vor der Entdeckung des Kalkriese Schlachtfeldes aufgestellt wurden, auch wenn dort keine Varusschlacht tobte, ließen sich vor dem Hintergrund des dort gewonnenen Mehr an Wissen der Statistik entnehmen. Was bleibt bietet immer noch genügend Ansatzpunkte für gute also weiter führende Spekulationen. Eine Herangehensweise wie sie oft erkennbar ist, wonach man sich nur einen beliebigen historischen Text und eine geeignete Geographie zur Hand nehmen braucht und schon liegt eine neue These auf dem Tisch ist sicherlich der falsche Weg. Sie mag zwar unterhaltsam sein, ist aber nicht zielführend. Denn das oberflächliche Aufspüren semantischer Interpretationsspielräume allein reicht nicht aus um Umfängliches zur Aufklärung beizutragen. Der Verlauf der Varusschlacht war dann zwar nicht mehr so stimmig, dafür passte aber alles gut in die Vorstellungen des Autors. Eine Methode die uns in die Abgründe der Geschichtsforschung blicken lässt, wenn man sich um den Aufbau geschlossener Argumentationsketten bemüht. Der Segestes Verrat oder seine Warnung, hat sich in den vergangenen 2000 Jahren verfestigt und offensichtlich glaubwürdig in der Weltgeschichte seinen ewigen Platz gesichert. Will man diese eherne, unumstößliche Säule und schwer zu erschütternde Überlieferung antiker Literatur antasten und nach anderen Erklärungen für den Untergang der Legionen suchen, um sie dann durch eine abweichende Theorie zu ersetzen, begibt man sich ins schwere Wasser zahlreicher Expertenmeinungen. Aber die Deutungshoheit ist Allgemeingut, sympathisiert mit einem schlüssigsten Konzept und Gewinner ist immer der, dem es nicht nur gelingt die besten Argumente auf den Tisch zu legen, sondern auch sie zum Sprechen zu bringen. Und auch Tacitus äußerte sich über Segestes den Mann im Hintergrund und berichtet über seine historisch dokumentierte ruchlose Tat. Aber dann geschah das Rätselhafte. Denn mit der Beschreibung der Geschehnisse am Vorabend und dem Hinweis von Tacitus, dass sich Segestes in die Varusschlacht mit hinein ziehen ließ endet bei ihm der „dokumentarische“ Teil quasi der Vorspann zur Varusschlacht und er vollzieht, warum auch immer einen bizarren Kapitelwechsel. Denn vom Jahr 9 + über das er zuletzt unter 1.55 (3) berichtete, sprang er unter 1.56 (1) direkt ins Frühjahr des Jahres 15 +. Aber welchen Grund mag es dafür gegeben haben, dass er nichts über den Verlauf der Varusschlacht hinterließ. Man weiß, dass auch einige Schriften der Tacitus Annalen verschollen sind. Insbesondere gehören dazu die Jahrbücher zu den frühen Jahren 29 + 30 + und 31 +, die man als besonders aufschlussreich betrachten könnte. Aber in diesem Fall wissen wir, dass Tacitus diese auch geschrieben hatte und es nicht nur auf vagen Annahmen oder Ankündigungen beruhte. Es waren Jahresberichte die, obwohl sie sich nicht auf das Jahr 9 + bezogen, dennoch Aussagen über die Schlacht enthalten haben könnten. Demzufolge lässt sich auch nicht völlig ausschließen, dass Tacitus nicht doch noch etwas über den Schlachtverlauf zu Papier gebracht haben könnte, was uns verborgen blieb. So könnte es Tacitus Paterculus gleich getan haben, denn Paterculus wusste auch mehr als das, was er uns auf schriftlichem Wege wissen ließ bzw. was uns mit viel Glück erreichte. Wissen, dass er für sich behielt und auf das nie das Licht der Neuzeit fallen konnte. (26.12.2020/17.01.2021)
... link
... older stories